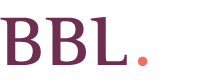BBL hat sich als eine der Top-Kanzleien im Bereich Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung in den letzten Jahren mit vielen Mandaten im Energiebereich befasst. Steigende Energiekosten und die korrespondierenden unsicheren Folgen für Stadtwerke und weitere Energielieferanten schaffen aktuell eine sehr herausfordernde Situation. Wie ist ihr am besten zu begegnen? Das ist die Frage, die uns alle bewegt.
Steigende Preise fordern Restrukturierung:
das Stadtwerke-Dilemma
Vor nicht allzu langer Zeit galten Stadtwerke – dabei insbesondere Energieerzeuger und Versorgungsunternehmen – als zuverlässige Finanzierungsquelle für strategische Zukunftsprojekte, die Bestrebungen gingen zuletzt deutlich in Richtung Rekommunalisierung. Nach der Erhöhung der Bezugspreise von Strom und Gas um zeitweilig bis zu 1.000 Prozent hat sich dies radikal geändert. Mit weitreichenden Folgen, nicht nur für den Finanzierungsbedarf, sondern auch für das operative Geschäft und die gesamte Finanz- und Ertragsplanung. Krisenszenarien frühzeitig zu erkennen, wird zum entscheidenden Moment.
Die krisenhafte Situation, die durch den Krieg in der Ukraine aber auch durch die Marktbereinigung bei Energiehändlern, die ebenfalls aufgrund gestiegener Einkaufspreise längerfristig gültige Preismodelle nicht mehr aufrechterhalten konnten, führte und führt noch immer zu massenhaften Kündigungen und Liefereinstellungen der insbesondere auf Verbraucher ausgerichteten Privatunternehmen.
Diese Entwicklung hat den Grundversorgern massenhaft – teilweise über Nacht – neue Kunden beschert. Doch gerade dieses Kundenklientel, das früher als „Cashcow“ galt, bereitet heute den Stadtwerkemanagern erhebliche Sorgen. Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Vorgaben ist es nicht möglich, die Grundtarife zeitnah den schnell steigenden Energiebezugs- bzw. Herstellungskosten anzupassen.
Aufgrund der Vielzahl von Neukunden im Grundversorgungstarif sind die Versorgungsunternehmen gezwungen, die notwendige Energie kurzfristig und damit teuer am Energiemarkt einzukaufen. Denn in der langfristigen Einkaufsstrategie konnten diese Kunden nicht berücksichtigt werden.
Hinzu kommt bei den Grundversorgungstarifen, dass die Versorger nicht zwischen langjährigen und neuen Kunden unterscheiden können. Während in anderen Tarifen die längerfristig bestehenden Kundenverträge auch von langfristigen Lieferverträgen profitieren können und Neukunden mit den gestiegenen Energiekosten stärker belastet werden können, ist diese Differenzierung bei der Grundversorgung gesetzlich noch nicht möglich. Dieses Problem ist bereits in der Bundespolitik erkannt und soll demnächst mit der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes gelöst werden.
Themen und Thesen im Detail.
Finanzierungsbedarf bereitet Kopfschmerzen
Nicht nur die Grundversorgungstarife stecken voller Schwierigkeiten – gerade die Finanzierungsprobleme gelten für alle Tarife für den Verbraucherbereich.Aufgrund des üblicherweise einjährigen Abrechnungsintervalls durch Ablesen der Verbrauchszähler ist in Zeiten stark steigender Preise mit deutlich erhöhten Nachzahlungen der Privathaushalte zu rechnen. Diese Nachzahlungen müssen durch die Versorgungsunternehmen für Zeiträume von bis zu zwölf Monaten und mehr vorfinanziert werden. Dadurch entsteht ein schnell steigender Liquiditätsbedarf, der durch eine Erweiterung der bestehenden Finanzierungen gedeckt werden muss. Daraus entstehen zusätzliche Finanzierungskosten, die ebenfalls bei der zukünftigen Preisgestaltung berücksichtigt werden müssen.
Das Problem des gestiegenen Finanzierungsbedarfes trifft die Versorger und Stadtwerke auch bei gewerblichen Abnehmern, wenn mit diesen längerfristig Festpreise vereinbart sind. Aber selbst bei flexiblen Preisgestaltungen, die an die aktuellen Preisentwicklungen der Energiebörsen anknüpfen, entstehen allein aus den deutlich höheren Preisvolumina bei gleichbleibenden Abnahmemengen und den Abrechnungsintervallen von üblicherweise einem Monat höhere Liquiditätsbedarfe.
Bereits die dafür notwendige Ausweitung von Kreditlinien dürfte einigen Stadtwerkechefs erhebliche Kopfschmerzen bereiten, zumal die finanzierenden Banken sich bei den Konditionen, insbesondere im gewerblichen Bereich, an den Bonitäten der gewerblichen Endverbraucher orientieren. Das heißt, dass eine schlechte Bonität der Kunden sich direkt auf die Kreditkosten der Versorger auswirkt.
Bedarf trifft auf Verlust
Bis dahin noch nicht berücksichtigt sind die auflaufenden Verluste, die sich aus dem Auseinanderfallen von Erhöhung des Einkaufspreises und Umsetzung von Preiserhöhungen insbesondere im privaten Bereich ergeben. Aufgrund der außerordentlichen Geschwindigkeit des Preisanstiegs kommt es immer wieder zu Verlustsituationen in den verschiedenen Tarifgestaltungen.Die erforderliche Verlustfinanzierung wird sich nur in wenigen Konstellationen im eigenen Unternehmen darstellen lassen. Denn hier kommt eine weitere Besonderheit von kommunalen Unternehmen zum Tragen: die Einflussnahme politischer Entscheidungsträger. Diese neigen dazu, in den Vorjahren entstandene Gewinne entweder zu entnehmen, um Haushaltslöcher oder Sonderwünsche zu erfüllen, oder sie stellen gewinnbringenden Unternehmen im Rahmen einer Holdingstruktur verlustreiche Unternehmungen gegenüber. So wurden unter anderem Spaßbäder von zweifelhafter Notwendigkeit lange Jahre querfinanziert.
Damit wurde aber auch die Krisenreaktionsfähigkeit strukturell eingeschränkt, da keine Rücklagen für jetzt anfallende Verluste aus dem Kerngeschäft zur Verfügung stehen. Oftmals stellt sich dann die Veräußerung von (weiteren) Anteilen am kommunalen Versorgungsunternehmen als letzter Ausweg dar. Dabei wird der Veräußerungserlös aber nicht an die Kommune ausgezahlt, sondern dem Unternehmen als Verlustausgleich zur Verfügung gestellt. Nur mit diesem Kunstgriff kann so manche „Braut“ für Investoren noch hübsch gemacht werden.
Krisen frühzeitig erkennen
Diese Gemengelage an Interessen und Einflüssen hat natürlich auch Folgen für das tägliche operative Geschäft. Kaufmännische Grundfertigkeiten sind gefragter denn je: Eine solide integrierte Finanz- und Ertragsplanung über einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten ist die Grundlage. Sie muss zeitnah aktuellen Entwicklungen angepasst, aber auch als Grundlage für Szenariorechnungen genutzt werden. Sollten diese Planungen auf ein mögliches Krisenszenario zulaufen, werden sich die Gesellschafter (Kommunen) fragen müssen, ob sie in der Lage sind, kurzfristig die erforderlichen Mittel zuzuführen.Ist das Unternehmen noch nicht akut von der Insolvenz bedroht, können auch mittelfristige Restrukturierungsmaßnahmen zum Erfolg führen. Deren Umsetzung muss unverzüglich und mit klarer Priorität gestartet werden. Dabei wird es oft auf eine Verminderung des kommunalpolitischen Einflusses zugunsten langfristiger Entscheidungssicherheit im Unternehmen ankommen. Darüber hinaus können auch durch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen wirtschaftliche Risiken in einzelnen Gesellschaften gebündelt werden und so der Einfluss auf gesündere Unternehmensteile reduziert werden.
Bei bestandsgefährdenden Krisenszenarien gilt es mit dem notwendigen Sachverstand den Schaden bestmöglich für alle Beteiligten und damit auch für die kommunalen Eigentümer zu begrenzen. Besonderes Augenmerk sollte frühzeitig auf die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Restrukturierung nach dem StaRUG gelegt werden. Dieses diskrete Verfahren dient insbesondere zur finanzwirtschaftlichen Sanierung von Unternehmen und muss vor dem Eintritt von Insolvenzantragspflichten eingeleitet werden.
Bei Insolvenzszenarien können insbesondere Schutzschirm- und Eigenverwaltungsverfahren einen erheblichen Beitrag zur Schadensbegrenzung leisten. Gleichwohl sind auch hier noch nicht alle Fragen geklärt, wie der bereits erwähnte Gesetzentwurf zum Energiewirtschaftsgesetz offenbart. Es stellt sich die Frage, was in der Insolvenz eines Grundversorgers mit den im Grundversorgungstarif versorgten Kunden geschieht. Der erste Entwurf sah ein Verbot der Vertragsbeendigung durch den Insolvenzverwalter vor, was die Risiken aber nur auf die weiteren Gläubiger des Unternehmens verlagert hätte. Der Insolvenzverwalter wäre zu einer Aufzehrung der noch vorhandenen Insolvenzmasse zugunsten der Kunden verpflichtet gewesen. Dieser radikale Einschnitt in Grundprinzipien des deutschen Insolvenzrechts scheint aber abgewendet. Eine Lösung des Problems ist damit aber noch nicht verbunden.
Gestaltungsmöglichkeiten nutzen
Die gute Nachricht – sofern man in diesem Zusammenhang von „gut“ sprechen kann – ist: Gerade im Schutzschirm- und Eigenverwaltungsverfahren liegen erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Der deutsche Gesetzesrahmen bietet im internationalen Vergleich eines der modernsten Restrukturierungsregularien, die eine schnelle gesellschaftsrechtliche Entflechtung, Neuordnung von Vertragsverhältnissen und die Berücksichtigung von Investoren ermöglicht. Dabei muss es nicht zwangsläufig zu einem Totalverlust für die vorherigen (kommunalen) Eigentümer kommen. Die Voraussetzungen für diese insbesondere auf den Unternehmenserhalt ausgerichteten Verfahren hat der Gesetzgeber zum Jahresbeginn 2021 noch einmal geschärft. Hier sind gute Planung und die Umsetzung mit restrukturierungserfahrenen Beratern und/oder Interimsmanagern erforderlich, um die Komplexität dieser Verfahren zu meistern.
Besonders im Fokus stehen bei allen denkbaren Abläufen aber die Entscheidungsträger in den Unternehmen: die Geschäftsführer:innen und mit ihnen auch Aufsichtsgremien wie Beiräte oder Aufsichtsräte. Sie sehen sich einerseits den Begehrlichkeiten und später auch den Ängsten der Kommunalpolitik gegenüber. Lassen sie sich dadurch von ihren gesetzlichen Pflichten abhalten, werden sie andererseits mit einem Haftungspotenzial konfrontiert, das üblicherweise nicht mit der Geschäftsführervergütung oder gar Aufwandsentschädigung für die Gremienarbeit abgegolten werden kann. Auch eine weitverbreitete D&O Versicherung bietet nur eingeschränkte Sicherheit. Hier ist Standhaftigkeit, solides Arbeiten und Kommunikationsfähigkeit gefragt. Die Grundlage dafür sollte immer eine erfahrene und konstruktive betriebswirtschaftliche und rechtliche Krisenberatung sein.
Ihre Ansprechpartner
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns.
Dr. Christian Heintze
Christian Heintze ist seit über 20 Jahren in der Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung tätig. Er verfügt als Insolvenzverwalter und Sanierungsberater über umfassende Erfahrungen bei komplexen, auch grenzüberschreitenden Unternehmenskrisen. Darüber hinaus berät er Investoren und Gläubiger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Insolvenzverfahren.
Heiko Schäfer
Heiko Schaefer ist seit über 15 Jahren im Bereich der Restrukturierung und Insolvenzverwaltung tätig. Er ist auf Betriebsfortführungen im Rahmen komplexer Insolvenzverfahren spezialisiert. Darüber hinaus berät er nationale und auch internationale Mandanten im Bereich Distressed M&A, bei Insolvenzen sowie im insolvenznahen Bereich. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung von Unternehmensorganen in Eigenverwaltungsverfahren nach dem ESUG.
Dr. Christian Heintze
Christian Heintze ist seit über 20 Jahren in der Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung tätig. Er verfügt als Insolvenzverwalter und Sanierungsberater über umfassende Erfahrungen bei komplexen, auch grenzüberschreitenden Unternehmenskrisen. Darüber hinaus berät er Investoren und Gläubiger bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Insolvenzverfahren.
Heiko Schäfer
Heiko Schaefer ist seit über 15 Jahren im Bereich der Restrukturierung und Insolvenzverwaltung tätig. Er ist auf Betriebsfortführungen im Rahmen komplexer Insolvenzverfahren spezialisiert. Darüber hinaus berät er nationale und auch internationale Mandanten im Bereich Distressed M&A, bei Insolvenzen sowie im insolvenznahen Bereich. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Beratung von Unternehmensorganen in Eigenverwaltungsverfahren nach dem ESUG.